Liebe Leserinnen und Leser
Jusletter IT gibt es nun bereits seit über fünf Jahren, Sie sehen hier die 19te Ausgabe vor sich. Seit Mai 2015 wurden Podcasts in Jusletter IT integriert, geplant ist ein umfassendes Archiv zu den IRIS-Tagungsbänden, Festschriften wurden publiziert… Das ist schon heute der umfassendste Wissenskorpus zu IT und Recht, auf den durch Suchmaschine und Metadaten weltweit immer und überall zugegriffen werden kann. Juristische Dienstleistungen werden mit immer mehr technologischer Unterstützung erstellt (bis zum sogenannten «Expertensystem») und richten sich auf einen globalen Markt; mit vielen regionalen Submärkten. Damit stellen sich viele Rechtsfragen neu oder in einem veränderten Kontext. Weltweit wird die IT als der Faktor zur Kosteneinsparung und Qualitätsverbesserung im Recht gesehen; Outsourcing ist gerade in deutschsprachigen Märkten als sehr eingeschränkte Option zu sehen.
Jusletter IT verschreibt sich hierbei der Interdisziplinarität und umfassenden Abdeckung aller Themen rund um IT und Recht, die für den digitalen Juristen wichtig sind.
In der letzten Schwerpunkt-Ausgabe von Jusletter IT am 21. Mai 2015 haben wir das Thema Big Data aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet. Hauptpunkt ist – wie bei vielen anderen Bereichen – der Datenschutz. Dieser lässt uns neben den verschiedensten Themen rund um IT und Recht – E-Commerce, Anti-Terror-Gesetze, E-Justice etc. – auch in dieser Ausgabe nicht los.
Rolf H. Weber fasst für uns zum Einstieg die Kernelemente der im Juni 2015 durch die EU-Kommission publizierten EU-Datenschutz-Grundverordnung zusammen. Neben der Stärkung des digitalen Binnenmarkts durch ein harmonisiertes Datenschutzniveau stehen die Informationsrechte, das Recht auf «Vergessenwerden» und auf Datenportabilität, neue Regelungen zum vorbeugenden Datenschutz und zum grenzüberschreitenden Datenverkehr sowie die verschärften Bestimmungen zur Überwachung als wesentliche Neuerungen im Vordergrund. Er zieht im Hinblick auf die eingeleitete DSG-Revision hieraus Lehren für die Schweiz.
Carlo Piltz führt seinen Blick nach Deutschland und auf die Entscheidung des Hamburger Datenschutzbeauftragten, der eine verwaltungsrechtliche Anordnung gegenüber der Facebook Ireland Ltd. erlassen hat und das Unternehmen darin unter anderem verpflichtet, die pseudonyme Nutzung seines Dienstes zuzulassen. Der Klarnamenzwang nämlich verstosse gegen deutsches Datenschutzrecht.
Was passiert mit meinem Account bei Facebook oder meinen Daten in der Cloud nach meinem Tod? Wie geht man mit meinem «digitalen Nachlass» um? Rolf H. Weber und Lennart Chrobak gehen Fragen der rechtlichen Zuordnung von Daten zu Lebzeiten und von Todes wegen nach. Unter Einbezug der gesetzlichen Rahmenbedingungen des Sachen-, Erb- und Obligationenrechts wird dabei die Frage diskutiert, inwiefern das Schweizer Recht dem Phänomen des digitalen Sterbens und Erbens gerecht zu werden vermag und welche Anpassungsmöglichkeiten für die Zukunft in Erwägung zu ziehen sind.
Auch Paweł Szulewski betrachtet die Übertragung von digitalen Vermögenswerten von Todes wegen. Er verweist am Beispiel von Facebook, Google und Yahoo! auf die Lücken in den einschlägigen Rechtsvorschriften der EU, zeigt aber gleichzeitig nicht-rechtliche Lösungsansätze auf und bietet einen Überblick zum Lösungsansatz der USA.
«Die Technik galoppiert voran – wo bleibt das Recht?» fragt Sandra Husi-Stämpfli. Sie betrachtet die technischen Hilfsmittel, die in den Alltag der Verwaltung einziehen und wie diese damit umzugehen hat. Dabei mahnt sie, dass ebenso ein Umdenken bezüglich der Übernahme von Verantwortung innerhalb der Verwaltung stattfinden, wie auch die ernsthafte Konzeption und Umsetzung einer kantonalen IT-Governance geschehen muss.
Peter Parycek, Johann Höchtl und Bettina Rinnerbauer widmen sich Big Data Analysen in der Verwaltung und deren Datenschutzrechtskonformität. Sie ziehen den «Use Case» der Registerzählung in Österreich heran, um einen ersten Vorschlag für die rechtskonforme Auswertung von Verwaltungsdaten durch ein neues Verfahren zu skizzieren.
Thomas Hansjakob zeigt im Anschluss an seinen Beitrag vom Mai 2015 (Der Einsatz von GovWare in der Schweiz, in: Jusletter IT 15. Mai 2014) die aktuellen Entwicklungen zur Revision von Art. 269ter StPO im Rahmen der laufenden BÜPF-Revision auf. Nach dem Ständerat will auch der Nationalrat künftig den Einsatz von GovWare («Staatstrojanern») zulassen.
Auch in Österreich wird das Thema Überwachung zur Bekämpfung von Straftaten heiss diskutiert. Rolf-Dieter Kargl hinterfragt die neuralgischen Punkte in der Rechtsordnung und stellt den Zusammenhang zwischen Mitwirkungspflichten privater Unternehmen z.B. nach dem E-Commerce-Gesetz und dem Telekommunikationsgesetz mit behördlichen Befugnissen nach Strafprozessordnung und Sicherheitspolizeigesetz dar. Zudem bietet er einen Ausblick auf die weiteren Schritte zur Entstehung des «Handlungskatalogs für die Evaluierung der Anti-Terror-Gesetze».
Die (Un-)Vereinbarkeit von Freiheitsrecht und Überwachung ist ebenfalls Thema der Urteilsbesprechung von Paul Bernal. Er kommentiert das Urteil vom Februar 2015 des UK Investigatory Powers Tribunal, welches den Datenaustausch zwischen den USA und UK für unrechtmässig erklärte.
Daniela Nüesch fasst die achte schweizerische Datenschutztagung, welche am 28./29. Mai 2015 zum Thema «Big Data und Datenschutzrecht» in Freiburg i.Üe. (Schweiz) stattfand, zusammen.
Virtuelle Währungen sind ein vieldiskutiertes Thema (vgl. auch Helgo Eberwein / Árpád Geréd, Bits & Coins, in: Jusletter IT 26. Februar 2015; Helgo Eberwein / Arthur Stadler / Anna-Zoe Steiner, Bitcoins – Rechtliche Aspekte einer virtuellen Währung, in: Jusletter IT 20. Februar 2014). Vlad Dan Roman fragt in diesem Zusammenhang, ob die Regulierung bei der rasanten Verbreitung und den immer wieder in Erscheinung tretenden neuen Anbietern noch mithalten kann.
Dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Massnahmen zum offenen Internet und zur Änderung der Verordnung über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union widmen sich Susanne Forizs und Tamás Forizs. Im Vordergrund der Analyse stehen die Auswirkungen auf den Endkundenvertrag in Form von Spezialvereinbarungen, verpflichtenden neuen Mindestinhalten für Verträge oder Gewährleistung.
Mit der strategischen Initiative Justiz 3.0 wird bis zum Jahr 2020 die vollständig digitale Aktenführung realisiert, um den Anforderungen an eine serviceorientierte Justiz seitens der Bevölkerung und der Mitarbeiter nachkommen zu können. Martin Schneider und Thomas Gottwald zeigen die einzelnen Punkte auf.
Federico Costantini schliesslich befasst sich theoretisch – untermalt von einzelnen Praxisbeispielen – mit dem Themenbereich «search for meaning» und rechtlichen Ontologien.
Pierre Brun bespricht den «Leitfaden Information Governance» in seiner neuen Auflage als willkommenes und umfassendes Hilfsmittel für Praktiker. Er zeigt konkrete Lösungen für die Sicherstellung der Ordnungsmässigkeit im Umgang mit der Ressource Information im Unternehmen auf.
Wie üblich finden Sie auch in dieser Ausgabe die TechLawNews von Daniel Ronzani und Simon Schlauri sowie weitere interessante News rund um IT und Recht.
Zusätzlich enthalten in dieser Ausgabe sind Podcasts, die im Rahmen des IRIS 2015 zum Thema Kooperation / Co-operation aufgenommen wurden. Diese ergänzen einzelne Beiträge zur Ausgabe von Jusletter IT am 26. Februar 2015 perfekt:
- Erich Schweighofer, Rechtsdatalystik – Versuch einer Teiltheorie der Rechtsinformatik (Podcast)
- Christine Kirchberger, Kooperation von Rechtsinformation und AnwenderInnen (Podcast)
- Iris Kraßnitzer, Medienneutrale Datenaufbereitung und kooperative Mehrfachnutzung von Kollektivverträgen (Podcast)
- Margit Vetter, «Google Like» Search in juristischen Datenbanken. Umsetzung bei Verlag Österreich (Podcast)
- Jörg Reichert, Recherchefunktionen und Anwenderverhalten in juris.de (Podcast)
- Pascale Berteloot, Anmerkungen zur neuen EUR-Lex (Podcast)
- Angela Stöger-Frank, Der Richter wird zum Autor. Titel, Abstract, korrekte Zitate: Ein Gegengeschäft oder Aufwand? (Podcast)
- Hanna Maria Kreuzbauer, Kooperation (Podcast)
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns, Sie am 19. November 2015 zur nächsten Ausgabe von Jusletter IT zum Thema E-Justice wieder begrüssen zu dürfen!
Wien / Bern, im September 2015
Wien / Bern, im September 2015
Datenschutz
E-Commerce
Telekommunikationsrecht
E-Justice
Rechtsinformation & Juristische Suchtechnologien



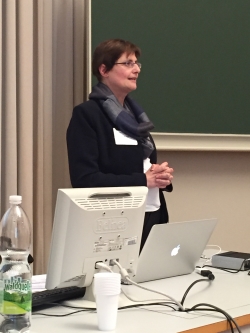

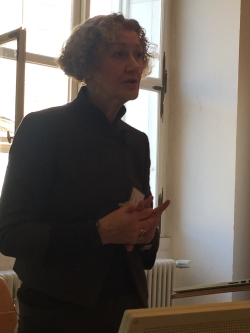

Zum Generalthema IRIS 2015: Kooperation

IT-Governance
TechLawNews by Ronzani Schlauri Attorneys
News
 Jusletter IT
Jusletter IT